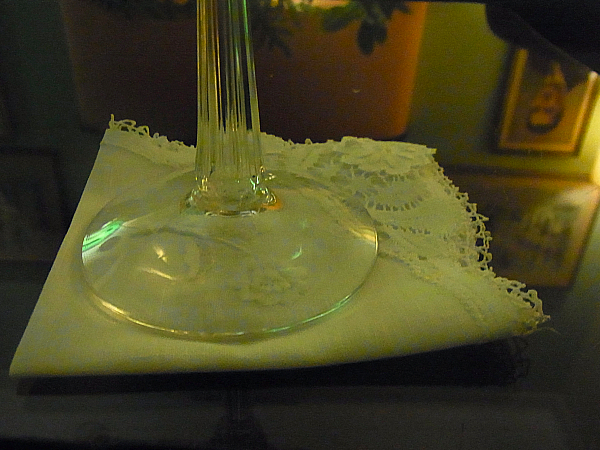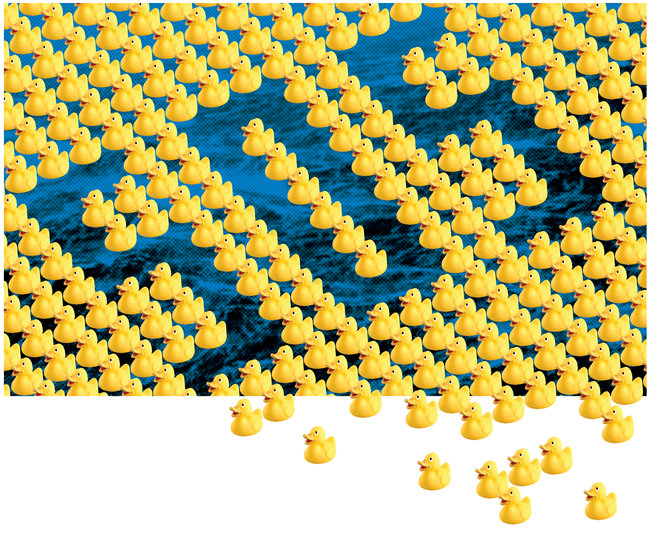Neue Heimat 12 1/2
Juan vom örtlichen Hafenagenten der Reederei Hamburg-Süd holt mich am Flughafen von Santo Domingo ab, eine echte Erleichterung. „Primera vez?“ fragt er – ob ich das erste Mal hier sei? Ja. So viele erste Male in diesem Jahr, dieses hier zählt kaum noch. Am Hafentor muss ich meinen Koffer öffnen, auch ein erstes Mal auf dieser Reise. Zwei Männer in orangefarbenen Schutzwesten, die nicht sonderlich nach Zoll aussehen, schieben meine Unterwäsche von links nach rechts und gucken dabei sachlich. Zwei weitere Männer stehen drumherum und gucken auch sachlich. Im Container der Hafenbehörde sitzt ein dicker Schnauzbart vor einer Plastikschale mit Reis und Bohnen, es ist Mittagszeit. Eingereist bin ich vor einer guten halben Stunde im Flughafen, jetzt reise ich wieder aus, Stempel, zack – so kurz war ich noch nie in einem anderen Land.
Doch noch bin ich nicht raus. Weiter, vorbei an Containerstapeln. Die Bahia Laura kommt zwischen Containern erst halb in Sicht, dann ganz, und ich werde erst halb, dann ganz still: „Wow.“ Juan lacht nur. 250 Meter, das ist… groß, wenn man davor steht. Noch größer, wenn man die Gangway hochgeht, einem philippinischen Matrosen hinterherstolpernd, der sich meinen 24-Kilo-Koffer mal eben auf den Kopf lädt und freihändig zwei Stufen auf einmal nimmt, während ich mich mit beiden Händen an der Reling festhalte.



Meine neue Heimat ist die Eignerkabine auf dem F-Deck, also ganz oben, direkt unterhalb der Brücke. Ein Wohn- und Arbeitszimmer, daneben ein Raum mit zwei Kojen und einem kleinen Duschbad. Der philippinische Steward Nonoy weist mich hastig ein und verschwindet dann wieder, er hat genug zu tun. Steward heißt auf Frachtern nicht: Sascha Hehn in weißer Uniform, sondern: Küchen-, Wäsche- und EInkaufssklave. Auf einem Containerschiff sorgen die wenigen Passagiere (wir sind zwei) selbst für ihre Kabinen, machen das Bett, putzen mal durch und waschen ihre persönlichen Sachen in der großen Gemeinschafts-Waschmaschine auf dem E-Deck.
Die Kabine – auf frachterisch: Kammer – ist geräumig und funktionell. Mein Laptop steht auf einer rutschfesten Matte, die Schreibtischlampe klebt mit Saugnäpfen auf dem Tisch, die Stereoanlage ist mit Klettband befestigt, Schranktüren und Schubladen sind extrem schwer zu öffnen, Gläser sind in ausgefrästen Löchern untergebracht – alles in dieser Kabine ist so konstruiert, dass sich bei schwerer See nichts vom Platz bewegen kann. Im Schrank drei Bücher, hinterlassen von meinen Vorgängern: Der Interviewband Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, Eckhart von Hirschhausens Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, und Unten am Fluss von Richard Adams. Natürlich fange ich mit Schmidt an. Am besten sofort. Koffer auspacken kann man auch später noch. Ich werde viel Zeit dazu haben: Die Fahrt nach Hamburg soll zwölf Tage dauern.

Das erste Mahl: eine Packung Dominosteine vom Bunten Teller, der an meinem Platz in der Offiziersmesse stand. Die Bahia Laura segelt unter liberianischer Flagge, aber zu Weihnachten ist auch sie ein deutsches Schiff. Mein Nachtisch: der linke Weihnachtsmann (Kopf zuerst abgebissen, klar).


Oh Käpt’n, mein Käpt’n
Eric Bergmann, eine knochentrockene norddeutsche Kodderschnauze, ist der Kapitän der Bahia Laura, aber nicht immer. Er wechselt die Schiffe, fährt unterschiedliche Routen. Vier Monate Dienst, vier Monate bezahlter Urlaub, „kein schlechtes Leben“, sagt er. Sein nächster Urlaub fällt in die Zeit der Fußball-EM, „genau so mag ich das.“
Er war mit 33 der jüngste Kapitän der Hamburg-Süd, das war vor 14 Jahren. Jetzt ist er einer der wenigen übriggebliebenen Deutschen – auf der Bahia Laura der einzige – der Reederei. Die anderen Offiziere und Ingenieure sind Polen und Filipinos, der Chefingenieur Tony ist Brite, die Deck- und Maschinenmannschaft ist komplett philippinisch. Zusammen mit mir sind wir 26, und natürlich bin ich die einzige Frau an Bord. Jeder, ausnahmsloser jeder, der mir begegnet, fragt, wie seefest ich sei. Winter sei Orkanzeit, es werde garantiert ungemütlich. „Erwarten Sie das Schlimmste, hoffen Sie das Beste“, sagt Sergio, der Dritte Offizier. Bergmann sagt gar nichts, sondern mufft nur, dass ihm natürlich mal wieder keiner aus der Zentrale gesagt habe, dass ich erst in Caucedo zusteige, er hat deswegen Ärger mit den Behörden in Cartagena bekommen, dafür werde er jetzt „ein paar Leute frisch machen“. Seine Laune ist sowieso nicht die beste, er legt seit sieben Tagen nur nachts an und ab, das sei nicht mehr lustig. In Caucedo hat er durch das lahme Beladen noch mehr kostbare Stunden verloren, die muss er jetzt bis Rotterdam gut machen, aber „noch haben wir ja Ententeich vor uns“.


Mahlzeit!
Frühstück von 7.15 Uhr bis 7.30 Uhr, Mittagessen um 12 Uhr (angekündigt durch eine Sirene), Abendessen um 17.30 Uhr, Erscheinen in Arbeitskleidung verboten. Die Kombüse liegt auf dem B-Deck, links und rechts davon die Essräume der Crew und der Offiziere. Ganz strikt getrennt sind die allerdings nicht: Der Zweite und der Dritte Offizier, beide Filipinos, essen lieber mit ihren Landsleuten. Viel verpassen sie ohnehin nicht bei uns: In der Offiziersmesse herrscht ebenso wie bei der Crew nüchterne Kantinenatmosphäre, dagegen kann die weihnachtliche Plastiktanne in der Ecke noch so viel anblinken. Alle schaufeln wortlos und hastig das Essen in sich hinein, länger als eine Viertelstunde sitzt keiner am Tisch, selbst mit Suppe davor und Nachtisch danach nicht. Wer aufsteht, sagt – und das oft als einziges – „Good afternoon“ und verschwindet umgehend. Monatelang mit denselben Leuten Tag und Nacht zusammenzuarbeiten killt jedes Bedürfnis nach großer Dinnerkonversation. Czeslaw, der Zweite Ingenieur, um die 50 und Typ Tankwart aus Lodz, wirft mir bestenfalls seinen Eine-Frau-bringt-sowieso-nur-Unglück-an-Bord-Blick zu.
Das Essen ist so, wie Essen für hart arbeitende Männer halt ist: morgens Eier mit Speck, mittags und abends warm mit Suppe, Fleisch und Dosengemüse, viel Pommes oder Kartoffelkroketten. Proviant wird alle acht Wochen in Hamburg geladen und in Kühl- und Gefrierkammern gelagert, nach vier Wochen wird in Valparaiso frisches Obst nachgekauft.


Geladen
Was in den Containern ist? Keine Ahnung, sagt Bartosz, der Erste Offizier (kahlrasierter Schädel, Ganzarm-Tattoo, Totenkopf-T-Shirt), darüber haben sie keine Frachtpapiere, nur für die Boxen mit gefährlichen Stoffen, mit Brennbarem oder Hochexplosivem. Oder für die rund 270 reefers, die weißen Tiefkühlcontainer mit Fisch, Fleisch und Mango aus Südamerika, die täglich zweimal kontrolliert werden müssen. Wieviele Container es insgesamt sind? Er zuckt wieder die Achseln, so ungefähr 1700 vielleicht? „Wozu hat man Computer?“
Beladen und gelöscht werden ist ein seltsam mesmerisierendes Vergnügen. Die surrenden Hängebrückenkräne stapeln die 40 Fuß langen Metallboxen wie Bauklötzchen übereinander, später gehe ich zwischen ihnen spazieren und lege den Kopf in den Nacken: so hoch wie fünfstöckige Häuser sind die Stapel.

Der andere
Ich bin nicht der einzige Passagier. In der Kammer des Vierten Ingenieurs wohnt Andreas, 52, Gartenpfleger. Als er mich zum ersten Mal anspricht, antworte ich verwirrt auf englisch, weil ich ihn anfangs überhaupt nicht verstehe: ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, wohnt er seit elf Jahren in der Nähe von Stuttgart. Er ist seit Valparaiso an Bord, also seit etwa zwei Wochen, hat auch schon die vierwöchige Hinreise mit dem Schiff gemacht und dazwischen fünf Wochen in Chile verbracht. Er redet aus dem Stand 20 Minuten am Stück sprudelnd und zusammenhanglos auf mich ein (die Katzen auf den Wochenmärkten, die fehlende Mülltrennung in Chile, die Größe von Avocados, seine Münzsammlung), offensichtlich froh, endlich einen Zuhörer gefunden zu haben.
Er wollte immer schon mal eine Schiffsreise machen, sagt er, wollte eigentlich rund um Kap Horn fahren, hat aber leider zu spät bemerkt, dass die Bahia Laura nur die Westküste abfährt; es habe doch „Südamerika-Rundreise“ geheißen… Und ja, die Zeit wird lang, es gibt an Bord ja nicht viel zu tun, klagt er. Am ersten Tag läuft man steuerbord hoch zum Bug und backbord wieder runter, und dann? Was macht er also den ganzen Tag, frage ich ihn. Handarbeiten, sagt er. Kleine Untersetzer aus Tauen. Es bricht einem das Herz.

Silvesterparty
So geht also dieses Jahr zu Ende: mit einem 30-Liter-Fass Bier in der Offiziersmesse, zwei Untertassen mit Erdnüssen und dröhnend lauten Jennifer Lopez-Videos im Fernseher. Die Polen sitzen auf dem Sofa und trinken still, wir anderen hängen an der Bar und trinken etwas lauter. Bergmann erzählt von Santos in Brasilien und seinem legendären Rotlichtviertel. Mit 16 war er zum ersten Mal da, von nix eine Ahnung. Irgendwer drückte ihm ein Mädchen in den Arm, auch so ein junges Ding. Große Liebe, klar, man tauschte Adressen und schickte sich Fotos. 30 Jahre später saß er mal wieder in einer Bar in Santos, da tippt ihm eine von hinten auf die Schulter: Ihre Freundin da hinten würde ihn kennen. Ach ja? Ja. Das Mädchen von damals. „Die kam dann rüber“, sagt er und schüttelt den Kopf, „und hatte allen Ernstes das Foto von mir als 16jährigem im Portmonnaie. Nach all den Jahren. Unglaublich.“ Und dann? Nichts weiter, bisschen geredet, fertig. Kein Hollywoodfilm.
Bis Mitternacht (bei 38 ° 30,2 N und 023 ° 41,5 W, also etwa 100 Seemeilen östlich der Azoren) halten nur fünf Leute durch: Czeslaw, der Elektriker Boguslaw, Tony, Bergmann und ich. Wir stoßen mit einem letzten Glas Bier an, wünschen uns gähnend Happy New Year und verziehen uns dann schnell in die Kojen, ein angenehm unspektakuläres Ende eines spektakulären Jahres.

Less is moi
Eine Woche auf See, die Tage verschwimmen. Von morgens bis abends und von Horizont zu Horizont nur Wasser, jeden zweiten Tag mal ein anderes Schiff in der Ferne. Das nächste Land, sagt Bergmann, ist vier Kilometer entfernt – der Meeresboden. Die Vorstellung von 3000 bis 4000 Metern Wasser unter uns finde ich faszinierend, überhaupt nicht beängstigend, eher beruhigend. Ich fühle mich getragen, geschaukelt, eingelullt von der gewaltigen blauen Wiege.
Ach, ich wollte so viel lesen, so viel schreiben. Stattdessen: morgens zwei Stunden im Bikini auf dem einzigen Liegestuhl des Dampfers auf einem Treppenabsatz unterhalb der Brücke dösen oder aufs Meer schauen und Hörbücher hören (Bartleby the Scrivener von Herman Melville, The Summer Without Men von Siri Hustvedt, Magical Thinking von Augusten Burroughs), nachmittags ein bisschen schreiben und weiter Hörbücher hören (und darüber einschlafen), zwischendurch mal auf die Brücke oder zu Tony in den Maschinenraum („Sie sind die erste Frau, die sich hier je den Maschinenraum hat zeigen lassen“). Und schon ziemlich bald nach dem frühen Abendessen in die Koje. Zusammengerechnet schlafe ich locker zehn, elf Stunden pro Tag – herrlich! Auch zeitlich nähern wir uns langsam der Heimat: Alle ein, zwei Nächte wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt.

Die entspannende Monotonie des Meeres und der langsamen Fortbewegung von etwas unter 40 Stundenkilometern ist direkt in mich hineingeschwappt. Und ebenso wie ich in meinem Liegestuhl stundenlang auf die See starren kann, kann ich mich obsessiv auf eine Sache einlassen, wie derzeit auf diese hier, eine CD, die ich wieder und wieder und wieder höre: Der klassische Cellist Yo-Yo Ma hat mit drei Bluegrass-Musikern die Goat Rodeo Sessions eingespielt (mein Lieblingssong „Here and heaven“ startet ab Minute 11:45). Goat Rodeo ist ein Begriff aus der Fliegerei und bezeichnet eine Situation, in der etwa hundert Dinge gleichzeitig klappen müssen, damit man heil aus einer Sache heraus kommt. Einen der Songtitel, „Less is moi“, würde ich mir glatt tätowieren lassen, wenn ich empfänglich für solchen Unsinn wäre.
Wie erkenntnisreich es sein kann, wenn man sich auf das wenige konzentriert, das halt gerade da ist, merke ich auch, als ich dreimal hintereinander die DVD der Bob Dylan-Hommage I am not there anschaue, die sich überraschend zwischen lauter Hongkong-Action und Kriegsfilmen in der Bordsammlung findet, die auf den Schwarzmärkten der südamerikanischen Häfen zusammengekauft wurde. Das erste Mal gucke ich im Original, danach mit dem Audio-Kommentar von Regisseur Todd Haynes, anschließend mit spanischen Untertiteln, als Sprachtraining – und ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt.


Rolling home
„Six degrees of freedom“ nennen Physiker und Seeleute poetisch das, was der Laie „höchste Wahrscheinlichkeit, kotzen zu müssen“ nennt. Ein Schiff fährt auf hoher See nicht nur vorwärts, sondern es stampft (bewegt sich also auf und ab) und rollt (schwankt von Seite zu Seite) und giert (bricht nach links und rechts aus). Diese sechs Bewegungen passieren in der Regel gleichzeitig, was man sehr schön am Pegelstand der Suppe sehen kann, die im Teller nicht nur sanft von links nach rechts schwappt, sondern sich gelegentlich auch walzerartig im Kreis dreht. Seit wir die Azoren passiert haben, ist aus Bergmanns Ententeich eine ruppelige See mit sechs Metern Dünung geworden und aus dem Dampfer ein Spielzeug der Wellen. Was nicht angeschraubt ist oder auf einer rutschfesten Matte steht, macht sich selbständig, meinen Tee trinke ich schon lange nicht mehr direkt neben dem Laptop. Trotz aller Vorsicht: Die Schreibtischlampe löst sich von ihren Gumminoppen und segelt quer durch die Kabine, meine in London gekaufte Teetasse segnet ebenfalls das Zeitliche nach einer besonders tückischen Welle – sie bekommt ein Seemannsgrab in der Biskaya.
Mir dagegen geht es fabelhaft. Kein Schwindel, keine Übelkeit und leider überhaupt keine Appetitlosigkeit. Der junge Schiffselektriker Marin, ein Kroate, wird jeden Tag ein bisschen grüner und zählt die Tage rückwärts („nur noch fünf Tage bis Hamburg, noch vier“), ich hingegen sehe mit Beklommenheit, dass das Ende der Reise jetzt wirklich unaufhaltsam näher rückt.

Kurz vor Erreichen von Rotterdam wird es noch mal spannend. Der Wintersturm lässt die Bahia Laura heftig rollen, bis zu 20 Grad legt sie sich auf die Seite – unmöglich für einen Lotsen, an Bord zu gehen. Und ohne Lotsen keine Einfahrt in den Hafen. Per Speedboot klappt es nicht, nachts um vier werden zwei erfolglose Versuche gemacht, ihn per Helikopter abzuseilen. Fünf Stunden später, bei kaum ruhigerer See, der nächste Versuch, diesmal klappt es, ihn auf dem Vorderdeck abzusetzen. Drei Stunden später liegen wir glücklich im Hafen, nur kann wegen der starken Windböen nicht gelöscht werden, die Hängebrückenkräne müssen pausieren. Warten, warten und auch noch einen zweiten Tag warten. Dann in der Nacht die erlösende Nachricht, dass jetzt alle Boxen an Bord sind, es kann weiter gehen – in den nächsten Sturm hinein, den bislang heftigsten der Reise. Windstärke 9, fiese Dünung, die hart ans Ruder schlägt und das Schiff beben lässt wie bei einem Auffahrunfall – es war für keinen eine ruhige Nacht. Ich schlafe wie ein Seestern, auf dem Bauch und alle Glieder von mir gestreckt, um mit maximaler Lakenhaftung möglichst wenig in der Koje umherzukollern – als würde man versuchen, ein Nickerchen in der Achterbahn zu machen.

Und dann die letzten Stunden vor dem Anlegen in Hamburg. Ich stehe im Dunkeln auf der Brücke, höre den leisen Anweisungen des Elblotsen zu („20 Grad steuerbord“) und sehe die Lichter am Flussufer auftauchen, erst von Cuxhaven, dann von Brunsbüttel, dann das ferne orangefarbene Leuchten von Hamburg. An Blankenese vorbei, an Teufelsbrück. Zwei Hafenlotsen sind inzwischen an Bord und dirigieren die Schlepper, die das 250 Meter lange Schiff sacht wenden und mit der Backbordseite an den Athabaskakai setzen.
KLONK.
Zuhause.
Hoffe ich jedenfalls.